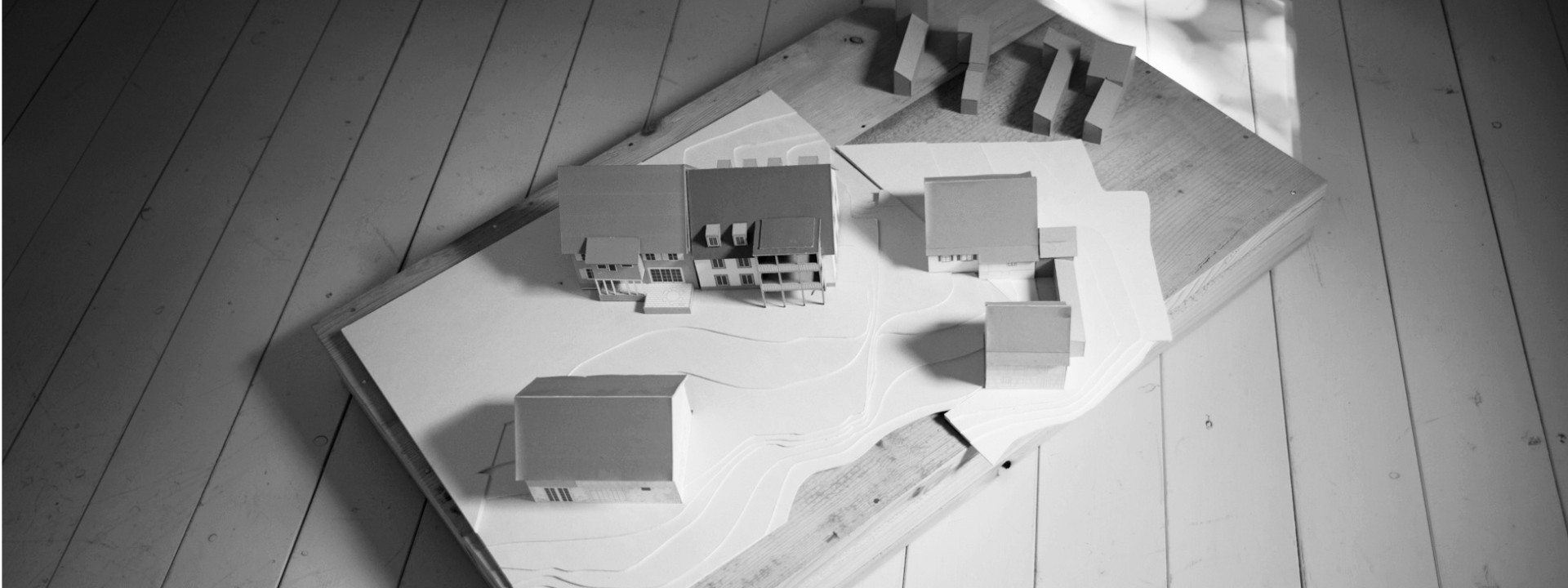Wie würden Sie Ihre Tätigkeit beschreiben?
Meine Aufgabe ist es, den Eigentümer zu beraten, den Spagat zwischen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit zu meistern. Einerseits möchten wir einen hohen Rechnungsbetrag, andererseits wollen wir an die künftigen Generationen denken. Da gibt es eine Vielfalt von Herangehensweisen. Für Wachstum und Holzqualität ist die waldbauliche Behandlung entscheidend. Ich versuche, den Wald naturnah zu bewirtschaften, indem ich die Gegebenheiten und die Gesetze der Natur berücksichtige.
Warum sind Sie Förster geworden?
Ich war schon immer gerne in der Natur. Durch meinen Großvater, der ebenfalls Förster war, lernte ich den Wald kennen. Nach meiner Lehre habe ich an der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg studiert. Als ich beim staatlichen Forstamt in Konstanz praktiziert habe, lernte ich die Bodmanschen Wälder kennen. Graf Bodman hat damals die forstliche Betriebsleitung vom Forstamt ausführen lassen. Dann kam die Stellenausschreibung als Revierleiter in der Allgemeinen Forstzeitschrift. Jetzt bin ich schon über 20 Jahre in Bodman.
Was macht den Bodanrück außergewöhnlich?
Primär sind das seine Lage und Beschaffenheit. Das Schroffe des Waldes, seine Wildheit. In manchen Tälern des Bodanrücks findet man Flächen, in die der Mensch seit der Eiszeit kaum eingegriffen hat. Dazu gehören auch die Ausblicke aus den Steillagen über den Bodensee. Die Molasseböden des Bodanrücks sind von ausgesprochen guter Qualität. Und die lange, kontinuierlich nachhaltige Bewirtschaftung der Familie Bodman hat einen biologisch ausgewogenen, natürlichen Mischwald entstehen lassen. Der Mix aus Landschaft, Geologie und Bewirtschaftungsweise ist tatsächlich selten.
Nachhaltige Bewirtschaftung – was heißt das?
In unseren Wäldern stehen 395 Kubikmeter Holz pro Hektar; jedes Jahr wachsen 10 Kubikmeter nach, daraus ergibt sich der jährliche Hiebsatz. Wir schlagen im Schnitt der Jahre das ein, was zuwächst, wobei wir nach einem bestimmten Schlüssel mischen, um einen gewünschten Erlös zu erzielen. Man darf nie vergessen, dass das, was wir heute pflanzen, erst in 60, 70 Jahren, mitunter erst in 120 Jahren geerntet werden kann. Nachhaltige Bewirtschaftung heißt aber mehr. Einen guten Baumartenmix, möglichst Naturverjüngung und vor allem die Beachtung der Standortverhältnisse. Was wächst auf welchem Boden am besten, und wie können wir die Fruchtbarkeit der Böden erhalten und fördern.
Was ist Ihre größte Herausforderung?
Wir haben umfangreiche Steillagen, die waldbaulich interessant, aber nicht maschinenbefahrbar sind. Hier sind die Gestehungskosten ungleich höher. Wir müssen weiter darauf achten, unsere innige Mischung aus Laub- und Nadelholz zu erhalten. Wir haben etwa 60 % Laubholz, überwiegend Buche, die hier optimale Verhältnisse vorfindet, und sich dadurch stark verjüngt. Wenn Flächen frei werden, müssen wir also auch aktiv Nadelholz pflanzen. Die sehr gut zu bewirtschaftenden Flächen auf der Hochebene des Bodanrücks müssen langfristig sinnvoll genutzt werden.
Nadelholz wächst schneller und bringt höhere Erlöse. Warum nicht ganz auf Nadelholz umstellen?
Die Familie Bodman ist mit Mischwald immer gut gefahren. Das macht den Wald weniger anfällig für Kalamitäten wie Sturmwurf und Insektenbefall. Wirtschaftlich gesehen ist Mischwald auch eine Garantie, den Markt besser bedienen zu können. Mal ist diese Holzart in Mode, mal eine andere. Eine möglichst vielfältige Mischung ist auch die bestmögliche Prophylaxe gegen den Klimawandel.
Welche Rolle spielt der Bodmansche Wald für das Unternehmen?
Der Wald ist unsere solideste Säule. Wir tragen mit dem Wald dazu bei, Ziele in anderen Unternehmensbereichen verfolgen zu können. Etwa die Restaurierung von Gebäuden oder den Ausbau der Mostanlagen im Obstbau. Neben der reinen Forstwirtschaft haben wir die Waldruh St. Katharinen entwickelt, für die ich zuständig bin. Derzeit kümmere ich mich um die Renovierung des kleinen Wasserkraftwerkes in Espasingen und helfe, dass die Hackschnitzelheizung in Bodman gut funktioniert.
Ist die Gewährleistung des Naturschutzes dabei nicht aus wirtschaftlicher Sicht kontraproduktiv?
Für mich gehört die Produktion von Holz auch zum Naturschutz, wenn man das vernünftig macht. Wieso sollen wir Bau- und Möbelholz von weit herholen und Öl statt heimisches, nachwachsendes Holz verbrennen?
Die ganze Bürokratie führt allerdings zu einem deutlich höheren Verwaltungsaufwand. 80 % unseres Waldes ist als FFH-Gebiet ausgewiesen. Der Schutzstatus schränkt die Flexibilität in der Bewirtschaftung ein. Wir dürfen etwa nicht mehr als 30 % Nadelholz einbringen, dabei ist es in der Jungwuchsphase notwendig, einen deutlich höheren Anteil zu haben, um in der Endwuchsphase 30% zu erreichen. Es ist falsch, wenn der Waldbesitzer, der ökologisch sinnvoll gearbeitet hat, dadurch bestraft wird, dass man seine Handlungsfähigkeit einschränkt. Ich sage es mal so: Wenn das Haus Bodman seinen Wald früher kahl geschlagen und überall Fichten gepflanzt hätte, wäre alles einfacher. Wir leben, wenn man so will, mit dem Fluch der eigenen guten Tat.
Wie planen Sie weiter?
Uns wurde vom Regierungspräsidium bestätigt, dass wir so weiter wirtschaften dürfen, wie wir das bisher getan haben. Wir planen in 10-Jahres-Schritten. Das Planwerk heißt Einrichtung und wurde mit externer Hilfe erstellt. Zuvor haben wir an 700 Punkten Stichproben genommen. Eine Vielzahl von Parametern wie beispielsweise Baumarten, ‑alter, ‑höhe, Bodenflora und Wildverbiss, wurden aufgenommen. So entsteht nach Hochrechnung ein genaues Bild der Naturaldaten. Daraus wird dann die Einrichtung gemacht. Die hat eine langfristige, nachhaltige Strategie. Das waldbauliche Ziel, der Einschlag, ökologische Kriterien, die Lenkung der Waldbesucher, die Wildstrategie und vieles mehr werden festgelegt. Dieser 10-Jahres-Plan wird dann auf die einzelnen Jahre runtergebrochen, und je nach Marktsituation, Witterungsgegebenheiten und Verfügbarkeit von Personal und Dienstleistern werden die Arbeiten durchgeführt.
(Reiner Bickel ist Diplom-Forstingenieur und kommt mütterlicherseits aus einer Försterfamilie; seine Ausbildung begann er in dem Forstamt, in dem sein Großvater Revierleiter war)